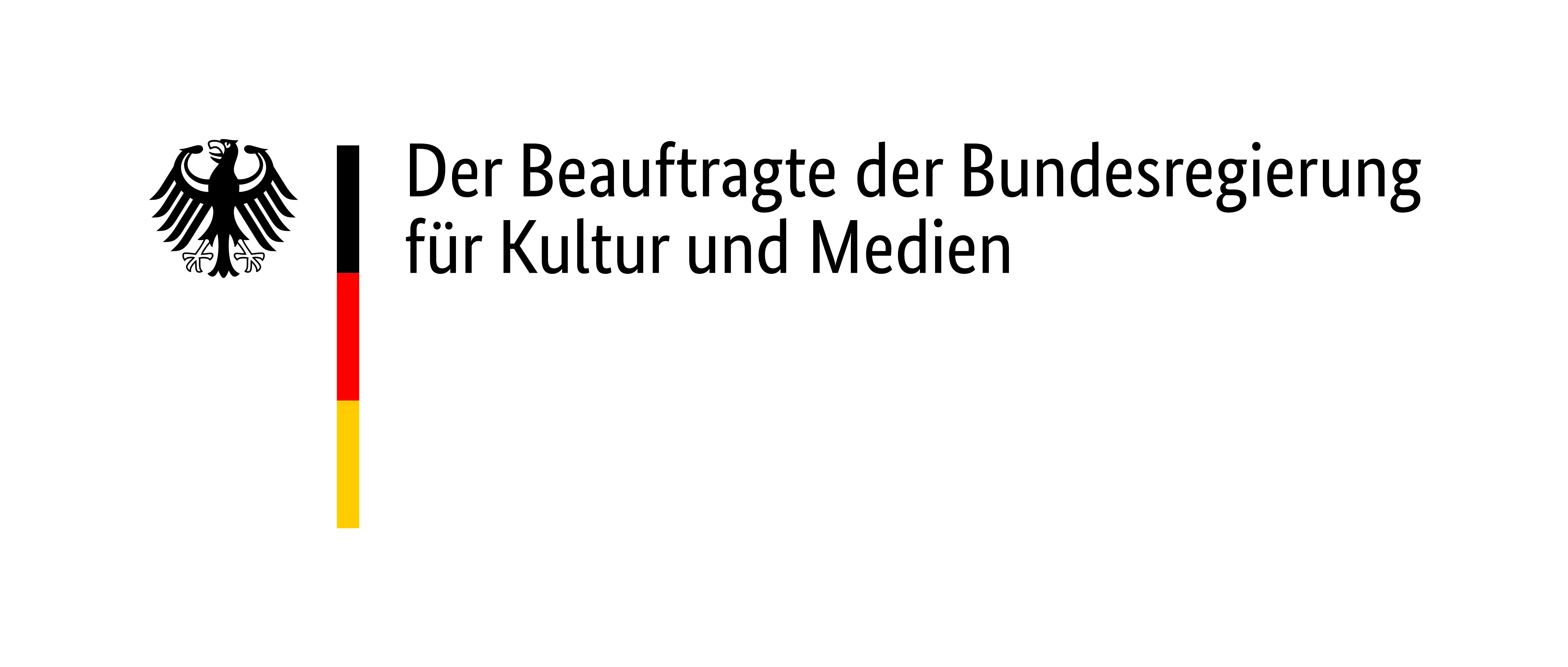Eine Oase mitten im Museum
Hygiene-Museum eröffnet neuen Garten im Innenhof
Das Deutsche Hygiene-Museum ist immer einen Besuch wert – das gilt ab sofort nicht nur für seine Ausstellungen, sondern auch für den großen Innenhof des Museums. Rund 2.300 qm Schotterfläche sind hier in den vergangenen Monaten entsiegelt worden. Wo früher nur Birken als botanisches Pendant zur geradlinigen architektonischen Linienführung des weißen Museumsbaus standen, wächst jetzt ein üppiges Dickicht aus Sträuchern. Die 700 qm umfassende Asphaltschicht auf der darüber liegenden Terrasse wurden durch einen wasserdurchlässigen gebundenen Kiesbelag ersetzt. Dort können die Besucher:innen künftig unter den Schirmen des Restaurants museumsKüche mit Blick auf einen farbenfroher Staudenteppich Platz nehmen. Wahlweise entspannen oder balancieren kann man auf roten Holzbalken, die das Areal durchkreuzen und dem neuen Garten einen ganz eigenen Charme verleihen.
Realisiert wurde das Projekt durch das renommierte Büro SOWATORINI Landschaft (Bochum und Berlin) um Sebastian Sowa und Gianluca Torini in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten von LA21 aus Dresden. Gefördert wurde die Maßnahme im Rahmen des Bundesprogramms Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland (INK) des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Im Programm werden Maßnahmen zum nachhaltigen Erhalt, zur Modernisierung und zur angemessenen Profilierung national bedeutsamer Kultureinrichtungen gefördert.
Mehr grün, weniger Hitze: Ein Leuchtturmprojekt zur Klimaverbesserung
Wie kann baulich auf die Folgen des Klimawandels reagiert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Hygiene-Museum aktuell mit 19 weiteren Kulturinstitutionen im Rahmen des Pilotprojekts „Klimaanpassung in Kultureinrichtungen“ der Kulturstiftung des Bundes. Dabei sind klimabedingte bauliche Anpassungen im Hygiene-Museum kein Novum: Bereits im Jahr 2002 wurde in Reaktion auf die damaligen Flutereignisse ein hochwassersicheres Depot unter der Museumsterrasse errichtet, das die Sammlungsobjekte vor zukünftigen Hochwasserereignissen schützt.
Mit der Neugestaltung des Innenhofs reagiert das Museum nun auf ein anderes Wetterextrem: In den vergangenen Jahren heizte sich der Hof im Hochsommer regelmäßig auf bis zu 50 Grad Celsius auf. Das neue Bepflanzungskonzept trägt zur natürlichen Kühlung des Gebäudes bei und verbessert zugleich das städtische Mikroklima. Zudem konnten durch die Neugestaltung hitzebedingte Schäden an der Gebäudesubstanz behoben werden: Unter der ursprünglichen Asphaltdecke der Terrasse hatten sich im Dach des Depots Risse gebildet, die zu Wassereintrag führten.
Der begrünte Innenhof dient aber nicht nur als kühlende Oase, sondern auch als idyllische Kulisse für Open-Air-Veranstaltungen. So wird er beispielsweise zum Spielfeld für das interaktive Spiel „Garten am Ende der Zeit“ (Premiere am 23.5.2025), das dazu einlädt, sich mit Fragen zur Zukunft und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen
Annekatrin Klepsch, Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum und Bürgermeisterin für Kultur, Wissenschaft und Tourismus:
„Mit der Neugestaltung des Innenhofs setzt das Deutsche Hygiene-Museum Dresden ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Stadt- und Kulturentwicklung im Kulturdenkmal. Hier ist ein Raum entstanden, der klimapolitisch zukunftsweisend ist. Die grüne Oase im Herzen des Museums ist ein Ort der Begegnung, der Bildung und der Erholung – und zeigt eindrucksvoll, wie Kulturinstitutionen aktiv zur Klimaanpassung beitragen können. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und gratuliere dem Museum zu diesem gelungenen Projekt.“
Dr. Iris Edenheiser, Direktorin und Vorständin, DHMD
„Mit dem neuen Garten schaffen wir nicht nur ein grünes Refugium mitten im Museum, sondern setzen auch ein starkes Zeichen: Museen können und müssen Orte der Nachhaltigkeit sein – inhaltlich wie baulich. Unser neuer Innenhof macht das Thema Klimaanpassung ganz konkret und sinnlich erlebbar.“
Lisa Klamka, Kaufmännische Direktorin und Vorständin, DHMD
„Wir wollten den Aufenthalt für unsere Gäste noch attraktiver machen – mit mehr Schatten, mehr Atmosphäre und einem Ort zum Verweilen. Der neue Garten ist nicht nur schön, sondern steigert auch die Aufenthaltsqualität spürbar. Ein echtes Plus für unser Publikum.“
Nachhaltigkeit am Deutschen Hygiene-Museum
Bereits seit vielen Jahren widmet sich das Museum in seiner Programmarbeit dem Menschen und seiner Umwelt. In Ausstellungen wie 2° – Das Wetter, der Mensch und sein Klima (2008/09), Shine on Me. Wir und die Sonne (2018/19), Von Pflanzen und Menschen (2019/20), Future Food. Essen für die Welt von morgen (2020/21) oder aktuell Luft. Eine für alle wird dieses Verhältnis aus ökologischer, gesellschaftlicher, technologischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Perspektive beleuchtet. In der Vermittlungsarbeit setzt das Museum auf Bildung für nachhaltige Entwicklung: In partizipativen Programmen mit Schulklassen werden Themen wie Klima- und Umweltschutz seit Jahren bearbeitet – unter anderem auch im Rahmen der sächsischen Klimaschulkonferenz, die im Februar 2025 im Hygiene-Museum stattfand. Veranstaltungen wie das Begleitprogramm zur Ausstellung „Luft. Eine für alle“ beleuchten Debatten um Nachhaltigkeit, Klimawandel und Stadtentwicklung und beziehen dabei auch das Dresdner Publikum aktiv mit ein.
Neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung setzte das Museum auch äußerlich Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und Biodiversität: Mit Hochbeeten auf dem Vorplatz, einer ökologischen Wildbienenzucht und einer Blühwiese wird die unmittelbare Umgebung des Hauses als naturnaher Lebensraum gestaltet. Bereits im Rahmen der Generalsanierung zwischen 2001 und 2010 wurden zudem wichtige bauliche Maßnahmen umgesetzt: Ein Niedrigenergiedepot für die Sammlung wurde errichtet, und die Klimatisierung der Ausstellungsräume erfolgt seitdem besonders umweltfreundlich über kühlendes Grundwasser.
Ausblick
Im Zuge der gesellschaftlichen Debatten zum Klimawandel gewinnt die Leitfrage des Museums „Wie wollen wir leben?“ eine neue Dimension: „Wie wollen wir zukünftig auf diesem Planeten miteinander leben?“ Vor diesem Hintergrund hat das DHMD im Jahr 2022 die Dresdner Charta für Nachhaltigkeit im Kultursektor unterzeichnet, die eine umfassende Nachhaltigkeitstransformation im Kulturbereich anstrebt. Die Charta verpflichtet Kultureinrichtungen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen in den Bereichen Beschaffung, Mobilität, Gebäudetechnik, Mitarbeiterförderung und Kommunikation.
Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt am DHMD partizipativ: Gemeinsam mit der Belegschaft wurde ein 100 Punkte Plan aufgestellt, um den CO2-Austausch des Museums zu verringern. Zu den zentralen Maßnahmen zählen die Einführung von Kreislaufwirtschaft im Ausstellungsbau, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, der Druck auf klimaneutralem Papier und die Senkung der Heizkosten. Neben dem Klimaschutz stehen auch bauliche Maßnahmen zur Klimaanpassung – wie die Neugestaltung des Innenhofs – im Fokus, um das Gebäude klimaresilient zu gestalten.
Entwurf und Begrünungskonzept
Text: SOWATORINI Landschaft
Zwei Raumatmosphären prallen in aller Heftigkeit aufeinander und machen das Einwirken von Raum auf Körper unmittelbar erlebbar. Diese Raumerfahrung soll freudvoll, positiv, spannungsvoll und vielschichtig sein und so das Thema des Hauses im Außenraum weiterzählen: Mehr Gefühl! Und wie schaffen wir das? Durch eine konsequente, kompromisslose Begrünung!
Die zwei Ebenen des Hofes sind nicht willkürlich, sondern sie berichten über ihr Verhältnis zur Erde. Der obere Teil ist unterbaut, liegt auf dem Dach des Museumsdepots. Der untere Teilbereich hat Erdkontakt. Der Entwurf thematisiert dieses Verhältnis zur Erde.
Der Entwurf: "Mehr Gefühl"
Oben: Bleibt es sonnig, exponiert und warm. Auf ca. 650 qm begleiten große Staudenrabatten die offene Fläche vor dem Foyer. Die vielfältige Mischung an Arten und Sorten ist auf die trockenen Verhältnisse, mit sehr wenig Substratraum angepasst. Aromatischer Duft, Leichtigkeit und ein ruhiges Farbspiel rahmen die Veranstaltungsfläche und wirken in den Innenraum hinein.
Dazwischen: Die Treppenanlage und die Rampe verwandeln sich in eine vermittelnde Struktur zwischen den Welten, die mit neuen Sitzelementen zum Aufenthalt einlädt. Ein hochspannender Ort mit Blick auf das kleine Bühnenplätzchen vor der dichten Vegetation.
Unten: Das Dickicht! Eine radikal andere Raumatmosphäre. Dicht, feucht und schattig. Ein barrierefreier Weg zieht sich durch den unteren Hofteil. Ein Netz aus Trampelpfaden und die roten, länglichen Elemente der Skulptur Pfadfinder fordern auf, sich in die Vegetationsatmosphäre hineinzubewegen, in Kontakt zu treten - mit der Natur.
Bepflanzung
Oben: ca. 10.000 Stauden und nochmal 10.000 Blumenzwiebeln sind in das Dachbegrünungssubstrat gepflanzt. Die beiden Flächen haben aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Besonnungslage ein unterschiedliches Artenspektrum. Das Tautropfengras und der Herbstkopfschwingel tauchen in beiden Flächen auf und ziehen die beiden Flächen gestalterisch zusammen. Neben Leichtigkeit, Bewegung, Duft und Farbe bieten die Flächen in den wechselnden Jahreszeiten, Lebensraum und ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Insekten.
Unten: Das Dickicht. Der untere Hofbereich wurde größtmöglich entsiegelt. Mehr als 100 Kubikmeter Substrat wurde in den Hof eingebracht, um ein dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum der Vegetation zu ermöglichen. Auf ca.1.000 qm Pflanzfläche wurden in großer Dichte ca. 850 Gehölze gepflanzt. Das Artenspektrum bedient sich dabei vor allem aus Gehölzen, die wir in freier Natur an trockenen Gehölzrändern wiederfinden:
Wildobst wie Kornelkirsche, dazu Feldahorn, Hartriegel oder Mehlbeere. Den artifiziellen Charakter des Dickichtes machen dabei ganz klassische Gartengehölze wie die Samthortensie sichtbar, die immer wieder im Dickicht auftauchen. Ergänzt werden die Gehölze von dezent in die Fläche integrierten Schattenstauden, die auf der Bodenebene die pflanzliche Atmosphäre verdichten.
Infos & Fakten
- Gesamtfläche Innenhof: 3.000 qm (unterer Hofbereich: 1.500 qm, oberer Bereich: 1.500 qm, davon 700 qm Terrassenfläche)
- artenreiche und äußert vielfältige Vegetationsstrukturen zur Erhöhung der Biodiversität
- Schattenwirkung und Verdunstungskühle führen zu einer signifikanten Reduzierung der Temperatur
- sehr hoher Anteil der Pflanzung an den Gesamtumfang des Projekts: Raum durch Vegetation
- Nutzung der großen Dachflächen des Museums für die Bewässerung (Pumpe, sondengesteuerte Bewässerung und Nebeldüsen)
- maximale Entsiegelung, weniger Oberflächenwasser in die Kanalisation
- Nutzung der großen Dachflächen des Museums für die Bewässerung (Zisterne, Pumpe, sondengesteurte Bewässerung und Nebeldüsen)
- barrierefreie Erschließung des Dickichtes und Integration der Anlieferzone in die Gesamtgestalt
- alle Einbauten sind Sonderanfertigungen und Teil des Gesamtkonzeptes
- Skulptur „Pfadfinder“ provoziert Aneignung, Spiel und Aufenthalt im Dickicht
- Planungszeit: Juni 2023 - Juni 2024
- Bauzeit: August 2024 - Dezember 2024
Team
Landschaftsarchitektur: SOWATORINI Landschaft (Berlin/Bochum)
Ausschreibung und Bauüberwachung: LA21 Landschaftsarchitektur, Miriam Bonitz, Marion Brod-Kilian, Steve Bösel, Diana Moraweck (Dresden/ Nordhausen)
Pflanzplanung: Design4planting, Dominic Wachs (Berlin)
Pflanzenlieferung: Deutsche Export Baumschule Bruns (Bad Zwischenhahn)
Bewässerungsplanung: Gardomat, Hr. Petzold (Dresden)
Statik: Engelbach+Partner, Hr. Weigert (Dresden)
GaLaBau Kohout (Dresden)
Sägewerk Geisler (Nossen)
Substratlieferung, Erdbau: Humuswirtschaft (Dresden)
Das Anlegen des Museumsgartens wurde gefördert durch: