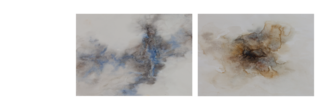Unscharfe Beziehungen – Die Beschreibung von Holobionten
In der Arithmetik des Lebens ist Eines immer Viele.
Viele ergeben häufig Eines, und Eines, wenn man es genauer betrachtet,
ist erkennbar aus Vielen zusammengesetzt.
Lynn Margulis und Ricardo Guerrero
Millionen Lebensformen sind, für das bloße Auge unsichtbar, in Alles und Jeden um uns eingewebt. Eines, sei es Pflanze, Tier, Pilz oder welcher komplexe Organismus auch immer, ist nie nur Eines. Die scheinbare Autonomie ist eine Abstraktion. Eines ist verstrickt in eine Fülle symbiotischer Vernetzungen durch Wechselwirkungen zwischen dem Einen selbst – dem Wirt – und dort ansässigen Mikroorganismen, die außerordentlich durchorganisierte Gemeinschaften bilden und in und vom Wirt leben. Solche Ansammlungen, bei denen nicht klar ist, wo die eine aufhört und die nächste anfängt, werden „Holobionten“ genannt.
Die Beziehungen zwischen einem Wirt und den ihm zugehörigen Mikroben sind komplex. Manche sind von erheblichem Nutzen, es entstehen sogar lebenserhaltende Abhängigkeiten: bei Korallen etwa, die nicht überleben könnten ohne ihre bakteriellen Partner. Andere Beziehungen sind mitunter parasitär oder gar lebensbedrohlich. Und noch andere wechseln von einer Kategorie in die andere, wenn sich die Umstände ändern: Etwas, das förderlich war, wird dann plötzlich gefährlich oder umgekehrt.
Die Beziehungen zwischen den „Gebilden“, aus denen sich ein Ganzes zusammensetzt, entwickeln sich im Laufe ihres Lebens dynamisch, je nachdem, welche Bedingungen ihre Umwelt, ihre Nahrung und andere Faktoren bieten. Da sie im Wesentlichen ein eigenes Ökosystem bilden, sind Holobionten alles andere als statisch.
In den letzten Jahrzehnten ist das Wissen über die komplexen Wechselwirkungen in Wirt-Mikroben-Ansammlungen schnell gewachsen. Dennoch lässt sich das Wesen des holobiontischen „Gebildes“ nicht leicht beschreiben, weder sprachlich noch visuell. Seine symbiotischen Paarungen und die sich ständig weiterentwickelnden Wechselwirkungen zwischen den Spezies halten sich nicht an Grenzen und entziehen sich der Festlegung.
Das gilt insbesondere für Spezies wie die unsere, die Menschheit. Hier lässt der Größenunterschied die mikroskopische Welt neben dem sehr viel größeren Körper des Wirts, der dem bloßen Auge als vollkommen umgrenzt, fest und einzigartig erscheint, verschwinden. Das hindert uns daran zu erkennen, dass wir ebenfalls Ansammlungen sind – eine Vorstellung, die unsere Selbstwahrnehmung in Zweifel zieht.
Die Suche nach einer angemessenen, einen Resonanzraum eröffnenden visuellen Annäherung an die Reichhaltigkeit dieser vielartigen Ansammlungen brachte mich dazu, mit der Nass-in-Nass-Aquarelltechnik zu experimentieren. Diese Technik scheint schon von sich aus in mancher Hinsicht den ungewissen Bewegungen und Prozessen auf der Mikroben-Wirt-Achse zu ähneln. Wie Aquarellfarben treiben und mischen sich die Organismen in einem flüssigen Milieu, überlagern sich und verschmelzen miteinander. Es sind diese Wechselwirkungen und nicht etwa die einzelnen Farbtöne, die Muster und Bilder entstehen lassen.
Dieser Ansatz ist ziemlich opportunistisch. Der:die Maler:in stößt den Prozess an, kontrolliert ihn jedoch nicht völlig, sondern folgt dem Fluss der Farbe und ergreift die sich bietenden Gelegenheiten, ihn auf eine gewünschte Gestalt hin zu steuern. Grenzlinien tauchen auf und verschwinden; die Farben verdünnen sich oder verstärken einander. Eine Gestalt tritt langsam unter äußerlich und innerlich wirkenden Kräften zutage und lässt sich nur in Maßen kontrollieren, ehe sie erstarrt.
In Wirklichkeit gibt es kein biologisches Gegenstück zu dem Augenblick, in dem das Bild beim Trocknen fixiert wird. Das letztlich entstandene Aquarell gleicht eher einem Schnappschuss, der eine Szene künstlich einfriert. Jenseits davon fließen die Farben immer weiter.
Olga Lukyanova, 2020
Auszüge aus diesem Artikel wurden zuerst veröffentlicht in: Bruno Latour und Peter Weibel (Hg.), Critical Zones. Observatories for Earthly Politics, Boston/MA: MIT Press, 2020.